Krawumm, Kneipen-Ragtime und ein beschwingt-fröhlicher Blick in den Abgrund vor dem großen Ende, das allerdings noch lange nicht erreicht scheint: Bob Dylans “Tempest”.

Finde die sieben Unterschiede: Bob Dylan im 21. Jahrhundert… (Bild: William Claxton/Sony).
Es gibt, in zwei Minuten wohlgemerkt, ungefähr zwei Dutzend Feuergefechte, man kommt gar nicht recht hinterher beim Mitzählen des potenziellen Bodycounts. “Strike Back” ist eine knallharte Action-Serie, die nicht wenige Fans als legitimen Nachfolger des stilbildenden Antiterror-TV-Schockers “24” ansehen, auch wenn nicht ganz soviel gefoltert, dafür aber in gängigen Krisenherden der Welt sehr viel mehr und vorwiegend sehr männlich geballert wird. Mit allen Kalibern und – klar – ideologisch weitgehend fragwürdig. Das haben Action-Serien nun mal so an sich. Es ist also ein mächtiges und andauerndes Krawumm, das diesen Trailer zur neuen Staffel ausmacht. Und ein neuer Song von Bob Dylan.
Von Bob Dylan wollte man sich in diesem Leben eigentlich nicht mehr überraschen lassen. Das ganze Gerede vom enigmatischen Genie, das mit berechenbarer Sicherheit bei jedem neuen Album die Feuilletons und (eher so Altherren-)Musikmagazine durchhaucht, schlägt ja auch einigermaßen schwer auf die Nerven. Aber das ist dann doch nochmal starker Tobak: “Early Roman Kings”, die erste offizielle Verlautbarung zum neuen Album per eben diesem Trailer abzuliefern. Wer hat sich das denn bitte ausgedacht?

… und zu “Desire”-Zeiten. (Bild: Ken Regan/Sony)
Man kann sich an diesem Bob Dylan mal wieder sehr erfreuen, 50 Jahre nach seinem Debütalbum wirkt er – soweit man das als Nachgeborener beurteilen kann – lebenslustiger und launiger als je zuvor. Nun ja, das mit der sonst gern gepflegten Altersweisheit funktioniert bei ihm nun wahrlich nicht, die hatte er bekanntermaßen schon in den ersten zehn Jahren der Karriere – man entschuldige den Kalauer – verballert. Der Bob Dylan des Jahres 2012 gibt verblüffend aufgeschlossene Konzerte, deren fast schon aufdringliche Spiellaune auch eingefleischte Dylanologen überrascht. Im Video zur Single “Duquesne Whistle” gibt er den souverän ungerührt durch die nächtlichen Straßen wandelnden leader of the pack; ansonsten werden taktgenau Kniescheiben zertrümmert, der Liebe wegen, versteht sich. Der Song selbst ist ein ebenso fröhlich rumpelnder wie beherzt krächzender Kneipen-Ragtime. Das ist also aus dem eigentlich als Sammlung religiöser Lieder geplanten Album geworden, für das er – und auch dieses Statement wundert dann wieder angesichts Dylans bekanntem Glaubenshang – einfach nicht genügend Songs beisammen gehabt hätte.
“Womit soll ich anfangen … Rimbaud auf den Fersen wie ein Querschläger tanzend durch die geheimen Straßen einer heißen New Jersey Nacht voller Wunder und Intrige.” Es wäre die ziemlich perfekte Beschreibung der Stimmung von “Duquesne Whistle”. Dylan schrieb das 1976 in die Linernotes zu “Desire”, ein mythisch-religiös untersetztes Werk voller Erlösungssehnsucht, auf dem man eine ganz ähnliche Soundkonstellation vorfindet wie heute, nur noch nicht so konsequent ins amerikanische Oldtime-Klangbild umgesetzt. “One more cup of coffee for the road, one more cup of coffee before I go. To the valley below.”, heißt es darauf im vielleicht schönsten Dylan-Ningel-Kitsch-Song überhaupt. Einen kleinen Aufschub möge die rätselhafte edelsteinäugige Schöne gewähren vor dem Weg ins Große Ungewisse.
Lass krachen!
“Tempest”, Der Sturm, heißt das neue Album, natürlich wieder so ein Brocken für die, beinharten Verschwörungstheoretikern frappierend ähnlichen, Dylan-Erforscher. Das späte Shakespeare-Stück hieß auch so und unter Shakespeare und Tod geht natürlich gar nichts bei der Einordnung des gerade so unverschämt – man muss es nochmal erwähnen – launigen Sängers. Ein Abgesang müsste das sein, als ein Vermächtnis mit alttestamentarischem Furor könnte man derlei inszenieren. Gewundert hätte sich niemand darüber. Aber Pustekuchen. Vielleicht lässt sich Dylan seine offensichtliche emotionale Ausgeglichenheit nicht mal mehr von sich selbst vermiesen. “Anything goes and you just gotta believe it will make sense.” hat er dem amerikanischen Rolling Stone erzählt – eines jener Magazine, die man im Gegensatz zu früher tatsächlich nicht mehr braucht, die aber doch noch standhaftes Bollwerk sein wollen gegen die totale Flüchtigkeit der Popmusik. (Die erkennt man vielleicht auch daran, dass kaum einer der vielen Möchtegern-Hipster, die sich das neue XX-Album – am selben Tag wie “Tempest” erschienen – gekauft haben, weiß, dass deren Sound bei den Young Marble Giants schon mal existiert hat. Gerade mal vier Jahre nach “Desire”. Das aber nur am Rand.)
Die letzten Alben von Bob Dylan seien seine bestverkauften, vermeldet das Plattenfirmen-Info stolz und man versteht nicht ganz, wie diese Kennziffern entstehen, weil es natürlich nicht wirklich sein kann, dass irgendein Jetztzeit-Album mehr Exemplare verkauft hat als – sagen wir mal – “Blonde On Blonde” oder “Highway 61 Revisited”, die zweifelsohne zu einem Kanon der Kulturbildung gehören, den auch ein “Tempest” niemals erreichen wird. Was ja das Wunderbare daran ist. Die Liebe ist hier eine grandiose Katastrophe aber sie klingt einfach zu gut für Traurigkeit. Die “early roman kings” der Gegenwart wirken wie ein obskur besoffenes Scherenschnitt-Abbild der Occupy-Hysterie. Und die Titanic geht mit lässigem Swing zu Grunde. To the valley below. Aber vorher bitte noch einen Kaffee.
Jörg Augsburg









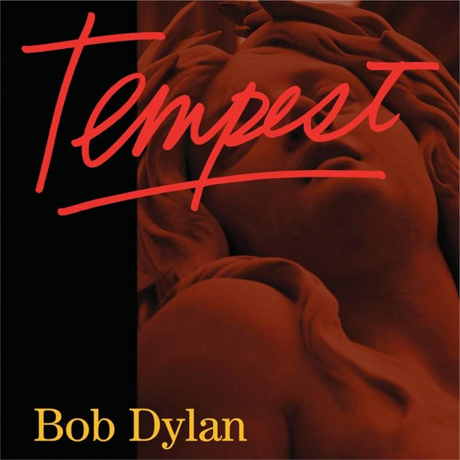
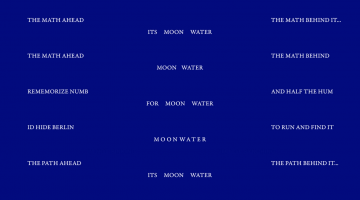
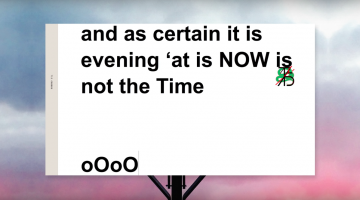

No Comment