Eines der Hauptziele eines Films ist, in der Regel, sein Publikum zu unterhalten, also – auf welche Weise auch immer – für gute Laune zu sorgen. Dass das nicht zwingend bedeuten muss, dass auch die Protagonisten auf der Leinwand gut gelaunt sind, lässt sich allerdings in dieser Woche mal wieder aufs Trefflichste beobachten.
„Watchmen“

Die „Watchmen“ beispielsweise sind Superhelden, wie sie scheinbar typisch sind für unsere heutigen Zeiten: geplagt von Identitätskrisen und Liebeskummer, Psychosen und Alkoholismus. Spätestens seit Christian Bales Batman wissen wir ja, dass man mittlerweile griesgrämig und deprimiert durchs Leben stapfen muss, um die Welt zu retten. Aber auch in den Achtzigern, in denen dieser – in jeder Hinsicht – bunte Haufen seiner Mission nachgeht, kam man damit schon durch. Missmutiger als diese „Wächter“ dürfte nur einer sein: Alan Moore, der Erfinder des legendären Kultcomics. Denn der hat jahrelang – und nun erfolglos – versucht, eine Verfilmung seines Meisterwerks zu verhindern.
„Gran Torino“

Auch um Clint Eastwoods Laune steht es in „Gran Torino“ einmal mehr nicht zum Besten. Von Altersmilde ist jedenfalls keine Spur zu finden bei diesem rüstigen Kriegsveteran und Witwer, der vom örtlichen Pfarrer bis hin zu den asiatischen Nachbarn eigentlich jeden hasst und im Zweifelsfall auch mal zum Gewehr greift, wenn jemand seinen Vorgarten betritt. Dass er, ähnlich übrigens wie die „Watchmen“, im Laufe des Films eine kleine Wandlung durchmacht, versteht sich von selbst. Aber genauso klar ist natürlich auch, dass er selbst am Schluss noch immer eher Dirty Harry als der nette Opa von nebenan ist.
„Sieben Tage Sonntag“

Keine Spur von Einsicht oder Besserung dagegen bei Adam und Tommek, den beiden Protagonisten in „Sieben Tage Sonntag“. Der trostlose Alltag im Plattenbau, ohne Job oder Schule, aber mit billigem Fusel und geklauten Zigaretten, hat sie gelangweilt und gleichgültig werden lassen. Als Unterhaltung oder gar Gute-Laune-Film mag man ihre Geschichte, die schließlich einen Toten nach sich zieht, weiß Gott nicht bezeichnen. Viel mehr hat der Debütfilm Niels Lauperts die Wirkung eines Schlages in die Magengrube, wie man so schön sagt. Aber gerade das macht ihn sehenswert.
„Marley & ich“

Das lässt sich nicht von allen neuen Filmen dieser Woche behaupten. Und so sind wir schon bei jenen Filmen, die in erster Linie nicht ihren Helden, sondern dem Zuschauer schlechte Laune bereiten. „Marley & ich“ etwa gibt sich größte Mühe, mit geballter Niedlichkeit seine kitschigen Botschaften an den Mann zu bringen. Doch schnell stellt sich heraus: dreimal Hundeblick – von Jennifer Aniston, Owen Wilson und dem Titel gebenden Welpen – ist eindeutig zu viel.
„Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“

Dreimal = zuviel, diese Gleichung gilt auch für Brendan Fraser, jenes ausstrahlungsarme Riesenbaby, das wir eigentlich einfolgreich in den Neunzigern zurückgelassen glaubten. „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“, der erste digitale 3D-Film aller Zeiten, ist nach „Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers“ und „Tintenherz“ Frasers dritter Film innerhalb eines halben Jahres. Warum ausgerechnet er in Zeiten der Krise mehr Jobs hat als alle Kollegen, bleibt rätselhaft, schließlich galt doch bisher eigentlich die Regel: drehe nicht mehr Filme im Jahr als du Gesichtsausdrücke beherrscht!
„Joy Division“

Um nun allerdings nicht schlecht gelaunt zu enden, sei schnell noch auf den Dokumentarfilm „Joy Division“ verwiesen. Dass auch hier mit Ian Curtis keine optimistische Frohnatur im Zentrum steht, wissen Fans der Band genauso wie alle, die im letzten Jahr schon Anton Corbijns Spielfilm „Control“ gesehen haben. Am tragischen Ende des Leadsängers führt jedenfalls kein Weg vorbei. Aber sehenswert, sowohl eigenständig als auch als zu Corbijns Werk passender Ergänzung, ist diese Verquickung aus Zeitzeugenberichten, Location Shots und raren Mitschnitten in jedem Fall.
Patrick Heidmann












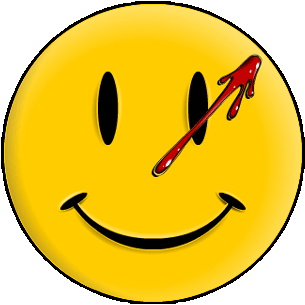
No Comment