Sommer 2010: “Schland schwitzt.” Dabei ist alles was fehlt ein bisschen kalifornische Lässigkeit. Den Soundtrack dazu liefert die Surf-Pop-Welle, die seit einiger Zeit durch die alternative Szene schwappt.

Die Beach Boys – Urgroßväter des Surf-Pops
Die Indiewelt dreht sich weiter – und zwar weiter zurück in Richtung Lo/Fi Surf-Pop. So subtil die Erklärung für das plötzliche Aufkeimen von Bands dieses Genres. The Drums sind die Pioniere des Revivals und veröffentlichen bereits letzten Monat das selbstbetitelte Debüt. Ende Juli ziehen Best Coast mit ihrem ersten Langspieler “Crazy For You” nach und Anfang August bildet “King Of The Beach” von The Wavves den Abschluss der Surf-Triade.
Nachdem sich viele Indie-Gruppen im Zeitalter der Leggings und Tigerprints ausgetobt haben, heißt es jetzt erneut Natürlichkeit statt schrillem Make-Up: Gitarren verdrängen Synthesizer und ein einfaches Effektgerät wird dem Mac-Book-Pro wieder vorgezogen. Nachdem die Trenduhr lange in der Zeit des Glitter und Glamour vergangener Dekaden stehen geblieben war, läuft sie jetzt weiter rückwärts. Wir landen an der Westküste der 60er: Die Beach Boys schreiben mit ihren ungewöhnlichen Harmonien, dem mehrstimmigen Gesang, den Texten über Teenagerliebe und ihrer hedonistischen Lebenseinstellung einen Hit nach dem anderen: „Surfing USA“, „Wouldn’t It Be Nice“ und „Don’t Worry Baby“ haben bis heute nichts an Optimismus eingebüßt.
.jpg)
„Oh Mama, I Wanna Go Surfing“ (The Drums)
Und jetzt die Wiederauferstehung. Eine Band, die eigentlich gar nicht aus Kalifornien, sondern aus New York kommt, greift die Melodien der Surf-Popper wieder auf. Die vier Jungs sind jedoch keine unkreative Kopie des Originals. The Drums stocken den sorglosen Strand-Sound mit düsteren Klängen der britischen Post-Punk-Strömung auf. Wenn man so will liegt Brooklyn ja auch fast auf halber Strecke zwischen Kalifornien und Manchester.
„The Drums“ sind ohnehin ziemliche Pessimisten. Sie glauben nicht an den Traum über Nacht zum Star zu werden. Eher ordnen sie sich irgendwo zwischen Eintagsfliege und One-Hit-Wonder ein.
Und tatsächlich polarisieren die Jungs: Befürworter sind begeistert von dem erfrischenden Sound, Gegner mäkeln an einstudierten Posen herum. Sänger Jonathan Pierce ist tatsächlich entweder ausgesprochen kalkuliert in seinen Bewegungen, die an einen epileptischen Anfall im Stile von Ian Curtis erinnern, oder ein kompletter Nerd, der keinen blassen Schimmer von dem hat, was er da eigentlich tut.
Ein Darwin Deez ähnlicher Geek-Faktor wäre sympathisch, trifft aber auf die trendkundigen Brooklyn Boys wohl eher nicht zu. Denn sie wissen genau, was sie tun.

„Why do we have to make this hard when it doesn’t have to be“ (Best Coast – The End)
Anders bei Best Coast. Das California-Girl Bethany Cosentino ist echt und ehrlich: Auf ihrem Twitter-Account gibt sie private Details von sich Preis und die Plaudereien über ihre Katze Snacks haben bereits eine eigene kleine Fangemeinde um den Vierbeiner entstehen lassen. Auf der Bühne kommen sie und ihre Songs direkt auf das Publikum zugeschossen. Das einzige was dazwischen liegt ist ein fettes Distortion-Effekt-Gerät. Der Sound ist eher schlicht: Drei-Power-Akkorde, ab und zu eine Bridge, in der alle den Surf-Pop-Choral „Uhuuhuuu“ einstimmen und hin und wieder ein Solo des etwas fähigeren Gitarristen Bobb Bruno. Selbstbewusst und direkt nennt Bethany in ihren Songs die Dinge beim Namen: „I wish he was my boyfriend“ heißt es gleich auf dem ersten Stück des neuen Albums „Crazy For You“. Keine ausgeklügelten Metaphern für Liebe und Sehnsucht. Wieso denn auch, wenn man genau so gut sagen kann, wie es wirklich ist?
.jpg)
„And I hate myself but who is to blame?“ (Wavves – Take On The World)
Ähnlich wie Best Coast hängen auch The Wavves dem eigentlich unbeschwerten Surf-Pop einige Kilos Mid-Twenty-Crisis und Liebeskummer an die Füße. Jedoch stehen bei Sänger Nathan Williams post-pubertäre Hoffnungslosigkeit („I still hate my music, it’s all the same!“) und Hybris („I won’t ever die, I’m a hero in my mind!“) nebeneinander.
Um die weiteren Einfüsse der Wavves zu verstehen, darf man zwar in Kalifornien bleiben, muss aber in die 90er Jahre zurückgehen: Punk besetzt den Bundesstaat. Unter den Eroberern befinden sich Green Day, die damals noch nicht poppige Charts-Hits komponierten, sondern mit Alben wie Dookie Neopunk Geschichte schrieben.
Der Bandname „Wavves“, das Album „King Of The Beach“: Die Wavves stehen zu ihrer Herkunft. Jedoch kann man den „Pop“ hinterm Surf da getrost durchstreichen und durch ein doppelt unterstrichenes „Punk“ ersetzten.
Shitgaze ist die neue Wortschöpfung für den Sound der Drei aus San Diego. Dahinter verbirgt sich der Noize, der entsteht, wenn man die Verstärker bis zum Anschlag aufdreht und alles an Verzerrern anschaltet was einem unter die Füße kommt.
So richtig über einen (Wellen-)Kamm lassen sich diese Bands jedoch nicht scheren. Surfen ist schließlich auch kein Teamsport. Trotzdem haben alle die Liebe zum spartanischen Sound wiederentdeckt. Während unsere technischen Möglichkeiten expandieren, klingen diese Bands eher, als hätten sie vor der Probe einfach auf die „Rec“-Taste ihres Kassettenrecorders gedrückt. Einige machen das ganz kalkuliert, Andere können einfach nicht anders. Beides funktioniert. Mehr davon.
Laura Gertken
The Drums – The Drums
VÖ: 04. Juni 2010
Label: Cooperative Music (Universal)
Best Coast – Crazy For You
VÖ: 20. August 2010
Label: Mexican Summer
Wavves – King Of The Beach
VÖ: 30. Juli 2010
Label: Fat Possum











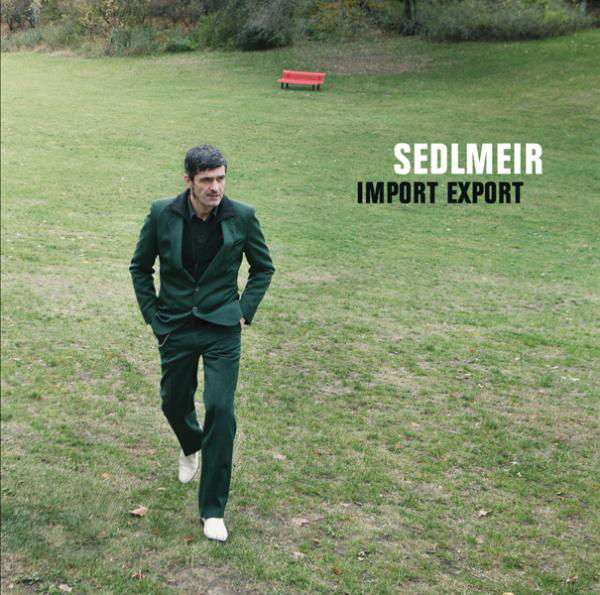
No Comment